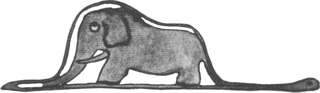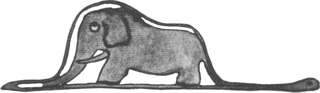Forschertagebuch
Donnerstag, der 1. August
(Red.) In einem verschlafenen Kaff inmitten des idyllischen Weiviertels (Name der Red. bekannt) lebt Familie L. (Name der Red. bekannt). Wie wir schon in unserer letzten Ausgabe berichtet haben, hält sich Familie L. in ihrem verwahrlosten Haus und verwildertem Garten ein exotisches Haustier, nämlich einen Elefanten. Der Streit um das Sorgerecht zwischen Familie L. und der Behörde (Name der Red. bekannt), die die Haltung des Tieres behördlich untersagt hat, spitzt sich zu. Vor allem Frau L. will mit allen Mitteln für das Recht auf Elefanten kämpfen.
Wir haben Frau L. in ihrem Haus im Herzen des niederösterreichischen Weinviertels besucht und zum Interview gebeten. Hier das Interview unseres Weinviertelkorrespondenten in ungekürzter Fassung:
L: Tschuldigung, es schaut ziemlich aus, ich bin noch nicht zum Aufräumen gekommen.
Red: In diesem Jahr?
L: Sehr witzig. Stört es Sie? Wir können uns gern in den Garten setzen, aber passen Sie auf, wegen der Brennnessel und Rosendornen.
Red: Nein nein, bleiben wir ruhig hier, kein Problem. Wenn ich gleich mit der ersten Frage beginnen darf...
L: Mit der zweiten. Die erste haben Sie schon gestellt. Aber macht nichts.
Red: Frau L., warum halten Sie sich ausgerechnet einen Elefanten, warum kein anderes, kleineres, exotisches Haustier, eine Schlange zum Beispiel.
L: Sie sind Psychonalytiker?
Red: Ich stelle hier die Fragen, wenn Sie erlauben. Also – warum sind Sie auf den Elefanten gekommen?
L: Sind bei Ihrer Zeitung alle so witzig wie Sie?... Also, wie kommen Sie auf die Idee, dass ich einen Elefanten halte? Vielleicht halte ich bloß einen großen Hut? O.k., ich sehe, Sie kennen den
Kleinen Prinzen nicht.
Ein veränderter Blickwinkel erweitert das Denken. Wenn Erwachsene erstmal davon überzeugt sind, einen Elefanten zu sehen, sind Sie nicht mehr in der Lage, einen Hut zu erkennen.Ist das nicht spannend?
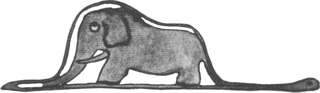
Red: Frau L., entschuldigen Sie bitte diese Frage, aber haben Sie psychische Probleme?
L: Nein, nur finanzielle. Raphale isst sehr viel, er ist ja noch jung und braucht das, das geht ganz schön ins Geld. Vielleicht könnten Sie ja in Ihrer Zeitung einen Spendenaufruf starten? Raphael ernährt sich nicht nur von Zweigen und dem Obst, er liebt vor allem Mohn. Die Mohnpreise auf dem Weltmarkt sind im Gegensatz zu den Goldpreisen im Steigen begriffen. Ich dachte da so an die Aktion „Mohn für Raphael.“
Red: Wer ist Raph... ah ja, der Elefant, ich verstehe.
L: Sie verstehen ganz schön viel.
Red: Sie haben meine Frage nach dem Grund für die Haltung eines Elefanten noch nicht beantwortet.
L: Ich halte keinen Elefanten, und schon gar nicht fest. Sehen Sie, er hat hier alle Freiheiten der Welt. Raphael hat sich uns ausgesucht, verstehen Sie? Klar, Sie verstehen ja alles. Wie Kinder und dreibeinige Katzen ihre Familie aussuchen, so hat sich auch Rapahel uns ausgesucht. Nur besondere Lebewesen suchen sich ausgerechnet unsere Familie aus.
Red: Ich ver... Was ist mit den Eltern von Raphael?
L: Das haben wir uns auch gefragt, wir wollten ja nicht einen kleinen Elefanten seiner Bauchmama entreißen. Wir haben einen der weltbesten Tierrückführungsspezialisten engagiert und sind draufgekommen, dass Raphaels Herde von Elfenbeinjägern erschossen wurde. Wobei... der Aufstellungsspezialist geht von einem Flugzeugunglück aus.
Red: Das tut mir leid.... Eine Frage noch zu Ihrem Garten?
L: Sind Sie von
Schöner Wohnen oder wie?
Red: Hat Ihr Elefant tatsächlich genug Auslauf hier?
L: Er hat einen verletzten Fuß. Er läuft im Moment ohnehin nicht weit. Aber wir gehen täglich mit ihm wandern. Raphael ist ein nordafrikanischer Waldelefant und die Leiser Berge sind für ihn wie geschaffen. O.k., ich überquere mit ihm nicht die Alpen wie Hannibal einst, aber der Buschberg ist auch wunderschön.
Red: Ich möchte gerne auf Ihren Kampf mit den Behörden zu sprechen kommen...
L: Dann tun Sie das doch!
Red: Sie haben gegen den Bescheid der Behörde Berufung eingelegt. Wie weit werden Sie noch gehen?
L: Bis zum Obersten Gerichtshof, wenn es sein muss auch bis zum Verfassungsgerichtshof. Es kann nicht sein, dass Behörden entscheiden dürfen, wie man artgerecht lebt. Eigenartig, oder? A
ls wäre es eigenartig, eine eigene Art zu haben. Das ist von Erich Fried. Ich halte das sowieso für eine eingefädelte Sache. Alle Nachbarn sorgen Sich liebevoll um Raphael, von denen hat uns niemand angezeigt.
Red: Jetzt wird es spannend. Irgendwelche Verschwörungstheorien?
L: Schauen Sie, wir sind hier im Weinviertel. Raphael verabscheut Wein. Den weißen grad so wie den roten. Er liebt Mohn. Na? Dämmert es?
Red: Sie glauben, die Weinwirtschaft hat ihre Finger im Spiel? Ist das nicht ein bisschen lächerlich?
L: Ich glaube das nicht, ich weiß es. Das war doch mit dem Hanf das gleiche. Die Bauern hatten Angst, dass er die Baumwolle vom Markt verdrängt. Jetzt haben sie Angst, dass die Weinviertler sich lieber am Opium berauschen anstatt am Grünen Veltliner. Dabei isst er nur Graumohn, nicht Schlafmohn. Wenn Sie jetzt bitte gehen würden, ich muss Raphael noch einen Mohnwickel machen.
Red: Frau L., wir danken für das Interview. Dürften wir noch ein paar Aufnahmen von Ihrer Wohnung und im Garten machen?
L: Sicher nicht. Meine Kontonummer können Sie haben, für den Spendenaufruf.
testsiegerin - 1. Aug, 13:24
Als ich vor mehr als einem Monat mit meinem Forscherinnentagebuch begonnen habe, war ich aufgeregt. Es war ein Experiment, von dem ich nicht wusste, wo es hinführen würde. Ich hatte Angst, dass mir schon bald nichts mehr einfallen würde, oder dass es total langweilig würde, weil ich bei dieser Reise allein sein würde und sich alles nur umdreht. Würde ich so viel über mich erfahren wollen? Würden mir nicht die Länder ausgehen, die ich bereisen wollte? Manchmal lag ich im Bett – ja, ich habe mir angewöhnt, im Bett zu schreiben, und ich schreibe mit der Hand. Auch das ist spannend zu beobachten, wenn ich in meinem Forscherinnentagebuch zurückblättere, wie sich meine Handschrift verändert hat. Ich habe jahrelang kaum etwas mit der Hand geschrieben, außer Einkaufszettel, oder manchmal in meiner Arbeit eine Post-it-Notiz mit „bitte 20x kopieren“, und sogar das habe ich abgekürzt. Jetzt ist meine Handschrift wieder eine Handschrift, und sie trägt meine Handschrift. Sie ist klarer geworden. Ich weiß nicht, ob ich selbst auch klarer geworden bin, das ich natürlich gerne schreiben, aber ich fürchte, das wäre gelogen. Wie man sieht, bin ich keineswegs klar, sonst hätte ich jetzt nicht den _Faden verloren, von dem man behauptet, er wäre rot. Kommt diese Metapher von Ariadne? War dieser Faden rot, der Ariadne aus dem Labyrinth geführt hat? Mich führt der Faden nicht hinaus, sondern hinein. In meine Verstrickungen und Verwirrungen und ich mag sie alle. Ich mag es sowohl, in den Fäden verworren zu sein als an ihnen zu ziehen.
Wie gesagt, ich hatte etwas Bammel vor dieser Reise. Trotzdem habe ich den Koffer gepackt und mich auf den Weg gemacht. Der Koffer war leer und ich fülle ihn mit Seiten. Mit Seiten dieses Buches. Auch mit meinen Seiten. Mit vielen unterschiedlichen Seiten von mir. Auch ein paar Saiten sind dabei.
Die Frau, die mich nämlich auf die Idee gebracht hat, war Geigerin. Geigerin, die irgendwann keine Lust mehr hatte, die zweite Geige zu spielen, weil sie andere Saiten in sich zum Klingen bringen wollte.
Oft liege ich in der Früh im Bett, noch voll von Träumen, von wirren Träumen, oder von Ideen, Rückblicken, Ausblicken, Einblicken, und überlege, worüber ich schreibe. Und dann nehme ich den billigen Kugelschreiber, ich glaube, das ist schon der vierte, und beginne einfach zu schreiben. Und das hat meistens nichts damit zu tun, was ich vorher überlegt habe. Oder es beginnt zwar damit und entwickelt sich in eine völlig andere Richtung. Ich habe geträumt, dass ich einen Elefanten geliefert bekommen habe. Seien wir uns ehrlich, das interessiert doch keinen.
Ich halte mich an die Regeln, die ich mir vorgenommen habe. Die Hand bleibt immer in Bewegung. Es wird nichts durchgestrichen, es wird nichts ausgebessert, es ist, wie es ist. Es gibt kein richtig und falsch. Mindestens 15 Minuten hab ich mir vorgenommen und im Moment, aber Körper und Geist haben grad Urlaub, und so wird es oft eine Stunde. Meine Hand gewöhnt sich daran, ich habe die richtige Liegeposition gefunden, in der ich gut schreiben kann – und lasse es fließen. Ungefiltert, natürtrüb fließt es aus mir heraus, plätschert manchmal einfach so dahin, schwillt an, andere Gedanken fließen ein, münden in den Schreibfluss, an manchen Stellen ein reißender Strom, an anderen eine Bergquelle, klar und rein manchmal, verdreckt und schlammig und all den Gefühls- und Gedankenmüll mitreißend ein andermal.
Und es darf einfach sein. Also darf auch schwierig sein. Es darf einfach sein, wie es ist, wie es will, nicht wie ich will will. Will will will... Wenn einem nichts einfällt, muss die Hand trotzdem in Bewegung bleiben, sie darf wiederholen wiederholen wiederholen aber nicht innehalten. Aber das passiert sowieso selten, dass ich beim Schreiben innehalte.
Eine der Regeln beim sogenannten Free writing Process – ich mag den Begriff Forscherinnentagebuch aber viel lieber – wäre noch: Es ist nur für mich. Nicht für die Öffentlichkeit. Diese Regel breche ich lustvoll. Die hab ich beinahe schon am ersten Tag meines FTB gebrochen, da schrieb ich „Wer bin ich“ und ich hatte danach total große Lust, es jemandem vorzulesen. Ich habe gemerkt, dass ich es auch bin, die sich mitteilen muss, die das, was sie tut, kocht, liebt, kann, denkt und schreibt mit anderen teilen will. Und muss.
Für euch mach ich mir – und eigentlich dann doch wieder nur für mich – für euch mach ich mir die Mühe die Arbeit die Lust das Vergnügen die Liebe die Leidenschaft den Zwang, alles abzutippen, was ich geschrieben habe, da und dort etwas zu ergänzen, weiterzuspinnen, in Form zu bringen, es lesbar zu machen. Es sind meistens nur so Kleinigkeiten, keine großen Änderungen und es verwundert mich meistens selbst. Das mein Hirn und meine Hand ziemlich strukturierte Geschichten einfach so runterschreiben können.
Ach ja, das ist mir so wichtig am Forscherinnentagebuch: Es ist, wie es ist. Es nimmt mir den Druck gut schreiben zu müssen. Es ist in diesem Moment nicht wichtig. Es einfach zu akzeptieren, dass manchmal etwas schönes entsteht, an dem es sich lohnt oder an dem es Lust macht, weiterzuschreiben; ich merke grad, dass mir das Wort Arbeit im Zusammenhang mit dem Schreiben nicht so gefällt, und jetzt ich kurz diesen ominösen roten Faden verloren, auf jeden Fall tut es mir wahnsinnig gut, diesen Druck, gut zu schreiben, ablassen zu dürfen. Pffffft... zischt er aus dem Ventil des Kochtopfs, der Druck, und entweicht. Übrig bleibt die Essenz, manchmal gatschig und zerkocht, manchmal bissfest.
Heute stelle ich diesen Text völlig unkorrigiert, ungefiltert und unverändert ins Netz. Naturtrüb. Wie ich. Und aus.
testsiegerin - 31. Jul, 11:14
Betreff: Artgerechte Haltung von Tieren
Ich nehme also Bezug auf Ihr Schreiben vom 27.7. in dem Sie mich darauf hinweisen, dass ich nicht berechtigt bin, in meinem Garten Elefanten zu halten. Einen Erlagschein haben Sie Ihrem Schreiben auch beigelegt. Einen Erlagschein. Wann kommen Sie im neuen Jahrhundert an?
Ich sag Ihnen einmal was. Ich hab Ihre Willkür so satt. Ihre Vorschriften. Ja, ich weiß, es braucht Regeln zum Zusammenleben, aber wir Menschen sind in manchen Bereichen durchaus fähig, miteinander Regeln zu vereinbaren – und diese zu übertreten. Kennen Sie übrigens das Buch Von den fortschreitenden Übertretungen des Major Aebi? Wir Menschen sind dazu geboren, von Regeln abzuweichen. Das nennt man L e b e n.
Ich würde Ihnen das Buch ja gerne schenken, aber bei Ihnen gibt es bestimmt ein Geschenkannahmeverbot, das Sie unterzeichnen mussten. Genau das meine ich. Auf eine Übertretung der Normen, weil Ihnen irgendjemand eine Million im Koffer übergeben hat, damit Sie etwas in seinem Sinn beeinflussen oder regeln, folgt ein strenges Gesetz. Eine Vorschrift. Sie haben die Relationen aus den Augen verloren, denn ich würde nichts erwarten von Ihnen, wenn Sie dieses Buch annehmen. Nicht einmal Dank.
Sie aber legen Ihre Regeln einfach wie einen Linienspiegel über das Leben und bestrafen jede Abweichung. Jede Ausnahme. Jeden Buchstaben, der zu lang geraten ist oder an einem falschen Platz gelandet ist. Sie ersticken damit die Kreativität im Keim. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass ich letztens in Salzburg irgendein Menschenleben gefährdet habe, weil ich 41 statt 30 gefahren bin. Das hat sich bestimmt Ihr Herwig Steiner, den ich mir damals ausgedacht hab, ausgedacht, weil er sich an mir rächen will. Weil mit diesem strohblonden Avril Lavigne – Verschnitt, den er nach unserem Beziehungaus geheiratet hat, todunglücklich ist. Weil er heimlich auf der Bezirkshauptmannschaft in meinem Blog liest (ich hoffe, Sie haben diese fortschreitende Übertretung seinem Arbeitsalltag sofort hart und unerbittlich geahndet?) und sieht, dass ich glücklich bin. Und weil er gelesen hat, dass es jetzt einen Herwig gibt, der mir nicht vorgegaukelt hat, ein Waldviertler zu sein, sondern tatsächlich einen Hof hat, nicht nur einen erfundenen mit pflegebedürftigen Eltern. Ich war nämlich dort, und dieser Herwig kann fantastisch kochen und hat mir gestern Mohnmarmelade geschickt. Haben Sie schon mal Mohnmarmelade gegessen? Herrlich, sag ich Ihnen.
30 Euro haben mich diese 11 zu schnell gefahrenen km/h gekostet. Ein bisschen überteuert, finden Sie nicht? Nein, ich erzähle Ihnen jetzt nicht, was ich mit den 30 Euro alles machen hätte können. Und Sie können nichts dafür, das waren Ihre Salzburger Kollegen, es gibt keine Sippenhaftung.
Zurück zum eigentlichen Thema Ihres Schreibens. Es geht also um Raphael. Ach, das können Sie ja gar nicht wissen, dass unser Elefant Raphael heißt. Es ist Ihnen zu Ohren gekommen, dass in unserem Garten Elefanten gehalten werden, schreiben Sie. Falsch. Hier muss der Singular. Ein Elefant. Ein kleiner Elefant noch dazu. Wie gesagt, er heißt Raphael, ein hübscher Name für einen Elefanten, oder? Wir finden, er passt zu ihm. Und Sie finden also, dass mein Garten nicht artgerecht ist? Sie kennen doch meinen Garten überhaupt nicht, weil Sie nämlich Ihre Ärsche überhaupt nicht hochkriegen aus Ihren weich gepolsterten Schreibtischsesseln in ihren klimatisierten Amtsstuben. Mein Garten ist artgerecht. In meinem Garten tummeln sich unendlich viele Arten von Menschen und Tieren und Pflanzen, wild durcheinander leben sie da und wachsen und wuchern und sind glücklich. Ah, ich verstehe, genau das beunruhigt Sie. Das wilde Durcheinanderleben. War klar.
Hören Sie mir mal zu. Biodiversität nennt man das. Aber bestimmt kommt eh bald ein Beamter aus dem Landwirtschaftsministerium, wahrscheinlich erst, wenn es kühler ist, man will sich der Hitze ja nicht aussetzen, und kontrolliert die Flügelspannbreiten unserer Libellen, die Schwanzlänge der Mäuse (hoffentlich nicht unserer anderen Bewohner) und den Schärfegrad unserer Chilis. Sehr scharf sind die, sage ich Ihnen. Beinahe gesundheitsgefährdend scharf. Aber wir wollen hier selbst entscheiden, wie wir unsere Gesundheit gefährden, verstehen Sie. Fast so scharf wie ich sind sie, unsere Chilischoten.
Ich sag Ihnen mal was: Seien Sie bitte froh, dass ich so ein höflicher Mensch bin und Ihr Schreiben überhaupt reagiere. Ich finde, ich nehme mir viel zu viel Zeit für Sie. Meine Tochter hat gemeint: „Schreib einfach zurück: Geh mischen Sie sich Ihnen da nicht hinein!“ Mein Mann hat ihr Schreiben zerrissen und gesagt: „Die sollen scheißen gehen!“
Sehen Sie, wie weit es gekommen ist mit Ihren ständigen Überwachungen und Regeln, die das Zusammenleben erleichtern sollen? Sie verunmöglichen es. Man nimmt Sie und Ihre Bescheide nicht mehr ernst. Sogar Kinder belächeln Sie. Tut das nicht weh?
Jetzt soll ich also € 3.869,- Strafe zahlen, weil ich in meinem Garten Elefanten halte. Da es sich ja in Wahrheit nur um einen handelt, gehe ich davon aus, dass die Strafe nur einen Bruchteil davon ausmacht, oder? Und davon ziehen wir noch mal ein Viertel ab, weil eine Pfote verletzt ist und er – trotz der täglichen Mohnwickel - nur mit 3 Füßen auftreten kann, ja?
Die Höhe - also ich meine jetzt nicht die Höhe der Strafe - kommt aber erst. Sie schreiben nämlich, ich soll die nicht artgerecht gehaltenen Elefanten an einen Zoo oder einen Zirkus, der eine entsprechende Genehmigung für die Haltung dieser Tiere hat, geben. (Lesen Sie auch heimlich mein Blog? Der Steppenhund hat nämlich etwas Ähnliches vorgeschlagen)
Sind Sie noch ganz bei Trost? Oder – um es mit den gewählten Worten meines Mannes auszudrücken – „hat Ihnen wer ins Hirn geschissen?“
Ich reg mich auf. Ich reg mich sowas von auf. Sie glauben ja selbst nicht, dass Raphael in irgendeinem schmuddeligen, schummrigen Zirkus artgerechter aufgehoben ist als in unserem Garten? In einem abgefuckten von Bezirkshauptstadt zu Bezirkshauptstadt tingelnden Zirkus, wo er dämliche Kunststücke vorführen muss und außerhalb der Vorführungen in einem Riesenkäfig eingesperrt ist? Wo die Mütter aus Mitleid hingehen, damit der Zirkus nicht ausstirbt, obwohl sie Zirkusse noch nie leiden konnten, und wo die Kinder aus Mitleid mit ihren Müttern hingehen und Freude heucheln? Wo halbnackte Tänzerinnen, die auch schon mal bessere Zeiten und bessere Kostüme gesehen haben, auf Raphael herumturnen und er einem depressiven Clown die Tränen aus seinem mit Make-up verschmierten Gesicht lecken muss? Wo keiner ihm Mohnwickel macht und ihn einfach in Ruhe lässt?
Raphael geht es gut bei uns. Er ist ein fröhlicher, kleiner Elefant, er isst viel, die Wunde heilt von Tag für Tag besser zu, die Katzen haben sich mit ihm angefreundet und Herta, der dreibeinige Kater, schläft am liebsten hinter seinem linken Ohr. Die Nachbarn bringen frisches Obst und haben ihn ins Herz geschlossen. Also mischen Sie sich Ihnen gefälligst nicht hinein!
Und kommen Sie mir jetzt nicht mit Ihrer Pflicht. Solche hatten wir schon genug, die nur ihre Pflicht getan haben. Ich kann das nicht mehr hören, wenn Menschen meinen, ihr Pflichtbewusstsein entbindet Sie von der Verpflichtung selbst zu denken. Oder hat man Ihre Gedanken eingesperrt, weil Sie es gewagt haben, gegen eine Ihrer unzähligen Verordnungen zu verstoßen?
Mit wütenden Grüßen
Barbara A. Lehner
P.S. Eine Kopie dieses Schreibens habe ich gleich selbst an die NSA, die NASA, das Innenministerium, die Finanzmarktaufsicht und den Papst geschickt. Arbeitserleichterung und so.
P.S.2: Wer hat uns eigentlich angezeigt?
testsiegerin - 30. Jul, 11:59
Vor vielen Jahren haben sie ihn hierhergebracht, in Handschellen. Er hat sich immer noch nicht an die Haft gewöhnt. Man gewöhnt sich nie daran, denkt er. Es wäre leichter, wenn er allein wäre, oder mit jemandem, mit dem er sich blind versteht. Aber hier sind so viele Mithäftlinge und er versteht die wenigsten von ihnen. Manche spielen ganze Nacht Karten und hindern ihn am Denken; andere spielen verrückt. Ein paar spinnen einfach so vor sich hin, diese Träumer.
Früher war er einer von ihnen. Einer der jungen Wilden. Hat immer wieder an den Gitterzellen gerüttelt, an den Zellergittern, an den Zittergellen oder den Gellenzittern, hat die Gitter zum Zittern und die Zellen zum Zetern gebracht.
Aber das ist lange vorbei. Jetzt freut er er sich sogar an seinen täglichen Runden im Hof; dabei geht der Gedanke im Kreis, immer und immer wieder. Sein Ansuchen auf Freigang haben sie abgelehnt. „Zu gefährlich!“ haben sie gesagt. Und die Sache mit den Ausbruchsversuchen hat er längst aufgegeben. Sie haben ihn immer wieder eingeholt, die Wachegedanken, die alles andere als wache Gedanken sind. Aber das hat er ihnen nicht gesagt, wozu sie beleidigen?
„Ich möchte bitte hier raus!“ hat er eine dieser Wachegedanken höflich gebeten, weil er verstanden hat, dass Druck nichts bringt, außer Gegendruck. Der vorwitzige Wachebeamte – pragmatisiert, oder verbeamtet, wie die deutschen Gedanken sagen – hat zynisch mit den großen Schlüsseln gerasselt und gesagt: „Dann geh doch! Die Gedanken sind frei!“
Leider nein, denkt der Gedanke. „Na gut, dann möchte ich zumindest mit dem Leiter der Gedankenvollzugsanstalt sprechen“, verlangt er, „das ist mein gutes Recht.“ Er wird zu ihm gebracht, in Handschellen, damit er sich unterwegs nicht verflüchtigt.
Der Leiter ist ein kluger, aber ein zynischer Kopf. Eine sehr häufige Kombination.
Unser Gedanke hält sich für einen besonders schlauen seiner Sorte, er will seinen Intellekt und seine Bildung beweisen, als er mit der flachen Hand theatralisch auf den großen Mahagonitisch des Direktors schlägt und aus Don Carlos zitiert: „Ein Federzug von dieser Hand, und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit!“
„Aber wieso?“, fragt der Direktor leise und schiebt sich die Ärmelschoner ein Stückchen höher, „ich dachte, die Gedanken wären ohnehin frei?“
Der Gedanke wird traurig. Mit gesenktem Kopf schleicht er wieder zurück in seine Stammzelle. Sein Stammheim. Er war ein gefürchteter, berüchtigter, terroristischer Gedanke, damals. Dabei hat er nur an Gerechtigkeit gedacht und geglaubt, und dass Gerechtigkeit nichts mit Kapital zu tun hat und er hat Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit für alle Gedanken gefordert; ja, sogar Schwesterlichkeit hat er gefordert, für die feministischen Gedankinnen. Was für ein törichter, romantischer Gedanke ich damals war, denkt er abgebrüht und desillusioniert.
Als er am nächsten Tag in seiner Großraumzelle aufwacht, die keineswegs groß, sondern lediglich überbelegt ist, vergnügen sich gerade ein paar schmutzige Gedanken. Er wagt nicht hinzuschauen. Ihn ekelt. Wie diese dreckigen, versauten Gedanken schamlos vor den anderen herumvögeln, denkt er.
Der Zwangsgedanke, der in der selben Zelle untergebracht ist, leidet darunter noch mehr als er. Er schlüpft in seine Latexhandschuhe und putzt die Gitterstäbe. Wieder und wieder, obwohl sie längst glänzen wie Gold.
Der Gedanke, der so gerne frei sein will, setzt sich in die Ecke der Zelle und denkt nach. Er schließt die Augen und hält sich die Ohren zu, denn er hält das Gestöhne nicht aus. Auch aus den Nachbarzellen dringt Lärm. Trotz der zugehaltenen Ohren zuckt er zusammen, als er hört, wie die Gitter zu Boden krachen. Berstende Scheiben. Schüsse. Schreie.
Er kauert sich tiefer in sich zusammen. Gewalttätige Gedanken machen ihm Angst. Das war nicht immer so, als er noch jung und ungestüm war, da hatte er selbst zu Gewalt aufgerufen. Deshalb war er schließlich hier, im Gefängnis. Mittlerweile – alt und gestüm – hat er kapiert, dass man mit Gewalt gar nichts erreichen kann, schon gar nicht die Freiheit.
Die jungen, ungestümen Gedanken haben ihn am Vortag ausgelacht, als er vom Direktor zurückgekommen und ihnen von ihrem Gespräch erzählt hat. „Und du willst ein vernünftiger Gedanke sein?“, haben sie gehöhnt und ihn nachgeäfft: „Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!“ „Freiheit kann uns niemand geben“, hat einer gesagt, der sich für den Knastphilosophen hält, „Freiheit müssen wir uns nehmen. Mit allen Mitteln.“
Sie trampeln über ihn hinweg und stürmen hinaus ins Freie, das sie mit der Freiheit verwechseln.
Unser Gedanke bleibt einfach sitzen und wartet. Er hat Zeit. Langsam lässt der Lärm nach, hin und wieder hört er noch, wie Einrichtung kaputtgeschlagen wird, als könnte sie etwas für die Vergehen der Gedanken, oder für die schrecklichen Haftbedingungen. Von weitem schreit jemand: „Der Direktor ist tot, es lebe die Freiheit!“
Irgendwann sitzt er ganz allein in der Zelle. Ein alter, einsamer Gedanke.
Ein fürsorglicher Mitgedanke ist noch einmal zurückgekommen. „Los, komm mit.Willst du denn nicht hinaus? Gib mir die Hand, ich helfe dir!“, bietet er seine Unterstützung an.
Der Gedanke schüttelt nachdenklich den Kopf und bedeutet dem mitfühlenden Mitgedanken mit einem Klopfen auf den kalten Boden, sich neben ihn zu setzen.
„Weißt du“, sagt er, „die Freiheit ist in uns, oder eben nicht.... Ja, halt mich ruhig für blöd oder pathetisch oder alles zusammen, aber ich bin zum Schluss gekommen, dass wir sie da draußen nicht finden, sondern nur, wenn wir endlich zur Ruhe kommen. Ich bin alt, ich habe viel gedacht im Leben, zu viel vielleicht. Zu viel gedacht und zu wenig genossen. Und zu wenig gespürt“, fügt er hinzu und seufzt.
„Aber fürs Spüren sind wir nicht zuständig. Dafür sind die Gefühle da, nicht wir“, widerspricht der mitfühlende Mitgedanke sich selbst.
„Wie auch immer. Ich bin zum Schluss gekommen...“, sagt er und stirbt.
Der fühlende Gedanke, der Widerspruch in sich, schließt ihm die Augen und deckt ihn mit einer gestreiften Decke zu. Er hat viel Erfahrung und weiß: Immer, wenn ein Gedanke stirbt, kommt ein neuer.
testsiegerin - 29. Jul, 12:38
Ein riesiger Lastwagen hält vor unserem Haus. Nicht schon wieder eine Baustelle, stöhne ich und gehe hinaus, um den Arbeitern Getränke anzubieten. Sie brauchen viel Flüssigkeit bei dieser Hitze.
„Bin ich hier richtig bei Lehner?“, fragt der Fahrer, öffnet die Seitenklappe seines Ungetüms, lässt die Laderampe herunter und den Elefanten heraus. Aber, möchte ich sagen, aber ich hab doch gar keinen Elefanten bestellt! Der Fahrer drückt mir den Lieferschein in die Hand. „Wenn Sie bitte da unten rechts unterschreiben, dass ich ihn zugestellt habe“, sagt er. Wenigstens ist das ein altmodischer Lieferschein aus richtigem Papier und nicht eines dieser modernen digitalen Kästchen der Paketzusteller, das ich einmal ruiniert habe, weil ich darauf beharrt habe, mit meinem eigenen Kugelschreiber zu unterzeichnen.
Der Lieferant reißt mir einen rosaroten Abschnitt vom Lieferschein herunter und drückt ihn mir in die Hand. Der Zettel sieht genauso aus wie der, den ich letztens bei der Schuhreparatur bekommen habe. Hoffentlich verwechsle ich die beiden nicht.
„Muss ich was bezahlen?“, frage ich ängstlich.
„Nein, alles erledigt.“ Ich ärgere mich über meinen Mann und rufe ihn sofort an. „Bist du schon ganz deppert?“, schreie ich ins Telefon und es ist weniger eine Frage als eine Feststellung, „du kannst doch nicht einfach einen Elefanten bestellen, ohne das vorher mit mir abzusprechen. Ich wohne auch hier, falls du das vergessen hast! Überhaupt: Was hat der wieder gekostet? Vorige Woche der Flügel, heute der Elefant, was kommt noch alles?“
Zunächst schweigt mein Mann kurz. „Jetzt reg dich doch nicht schon wieder so auf“, sagt er dann, „ich wollte es dir eh sagen, aber dann hab ich vergessen, und du bist ja nie daheim.“
Der Lastwagen startet. Wahrscheinlich will der Fahrer nicht in unseren Ehestreit hineingezogen werden. Wahrscheinlich hat er zu Hause seinen eigenen und ist damit ausreichend bedient.
„Na gut“, sage ich ins Telefon, jetzt ein wenig versöhnlicher. Ich denke an mein letztes Kommunikationsseminar. Das VW-Modell. Vom Vorwurf zum Wunsch. „Ich wünsche mir, dass du mich das nächste Mal in solche Entscheidungen miteinbeziehst.“
Ich höre, wie er seine Augen rollt, aber auch er lenkt ein. „Ja, mach ich. Überhaupt - er ist eh noch klein“, sagt er.
Na gut, denke ich, wir werden auch diese Situation irgendwie meistern, so wie wir in den letzten fünfundzwanzig Jahren schwierige Situationen gemeistert haben.
Der Lastwagen fährt mit einem Rumpeln weg. Der Elefant schreit. „Ist ja gut“, tätschle ich ihn an der Seite, „alles wird gut.“ Wahrscheinlich hat er Heimweh, denke ich. Wir könnten später gemeinsam Universum schauen, da ist bestimmt ein Bericht aus deiner Heimat dabei. Vermutlich hat er aber auch Hunger. Ich biege einen Ast des Birnbaums herunter. Ich hab mich noch nie darum gekümmert, was Elefanten so essen. Ich schaue auf den Gehsteig, ob der Lieferdienst zufällig eine Bedienungsanleitung dagelassen hat. Nichts. Aber ich sehe, warum der Elefant so schreit. Er ist an den Zehen verletzt. Der Lastwagen ist über seine Pfoten gerollt, als er weggefahren ist.
Mir schießen Tränen des Mitgefühls und des Zorns in die Augen. „Jetzt mal rein mit dir, kleiner Bimbo“, sage ich und beiße mir auf die Zunge. Bimbo darf man bestimmt nicht sagen, das ist rassistisch. Außerdem kann ich nicht erkennen, ob der Kleine aus Afrika oder aus Indien ist, und zu einem indischen Elefanten Bimbo zu sagen, ist noch mal so schlimm. Einer von beiden hat Schlappohren, erinnere ich mich an den Biologieunterricht. Aber welcher?
Jetzt ist auch die Nachbarin auf der Straße: „Was ist denn bei Ihnen schon wieder los, Frau Lehner?“, fragt sie.
„Nichts, nichts“, sage ich, „er wird sich gleich wieder beruhigen.“ Ich weiß nicht, wie ich ihn ins Haus bringen soll, er hat ja keine Leine dran. Also greife ich behutsam sein Ohr und führe ihn die Einfahrt runter. „Vorsicht, steil!“, warne ich ihn, aber das scheint ihn nicht zu stören.
„Guten Morgen“, verschlafen kommen die Mädels aus dem Zimmer. „Mich hat was aufgeweckt“, sagt Theres und reibt sich die Augen. „Dabei bin ich noch gar nicht fertig mit schlafen.“ Als sie den Elefanten sieht, rollt sie die Augen und sagt: „Dieser Papa. Was dem immer einfällt!“ Rosi dagegen kann ihr Glück kaum fassen. „Oh Gott, ist der süß!“
„Das ist Raphael“, sage ich. Der Name ist mir grad eingefallen und bestimmt weder afrikanisch noch indisch noch rassistisch.
„Schau mal, er ist verletzt“, sagt Rosi, als sie die Wunde sieht, „wir müssen ihn verarzten.“
„Soll ich die Tierärztin anrufen?“, fragt Theres. Sie erreicht sie nicht. Zum Glück, denke ich, denn sie ist nur für Kleintiere zuständig, und Raphael fällt wohl trotz seiner Jugend eher nicht in diese Kategorie.
Ein wenig später kommt Rosi mit einem Kübel Lindenblütentee mit frischen Ringelblumen drin und einem Leintuch als Verband, um ihn zu verarzten. „Den Tee macht mir meine Mama auch immer, wenn ich krank bin.“ Raphael leckt ihr dankbar übers Gesicht und trinkt den Kübel leer. „Er hatte Durst“, sagt Rosi entzückt, „habt ihr gesehen, wie gierig er getrunken hat?“
Theres ist da realistischer. „Vorsicht“, sagt sie, „was oben reinkommt, kommt meistens unten wieder raus.“
Wir bringen Raphael in den Garten. Ein wenig unsicher schaut er sich um, Rynn und Hermes, die beiden Katzen, flüchten ängstlich auf den Zwetschkenbaum. Nur Herta, der dreibeinige Kater, beschnuppert Raphael neugierig und beginnt dann, an seiner Wunde zu lecken. Wahrscheinlich freut er sich, dass er nun nicht mehr der behinderte Außenseiter in der Familie ist. Ich stelle die beiden einander vor: „Raphael“, ich deute erst auf den Elefanten, und danach auf den Kater, „und das ist Herta!“
Herta schnurrt zufrieden. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber auch aus Raphaels Innerem ertönen Geräusche der Wohligkeit. Ich glaube, die beiden werden Freunde.
„Ich mach uns jetzt erstmal auch was zu trinken“, sage ich und bitte die Mädels, in der Zwischenzeit auf unser neues Familienmitglied aufzupassen. „Wir werden das Kind schon schaukeln“, sage ich zu mir, als ich den Tee aufgieße, „wir sind schließlich schon mit schwierigeren Situationen als einem kleinen Elefanten fertig geworden.“
testsiegerin - 27. Jul, 10:27
„Warum lernen wir Geschichte?“, hat der Geschichtsprofessor am Beginn der ersten Stunde im Gymnasium gefragt. Und sich auch gleich selbst die erste Antwort zu geben. „Um aus ihr zu lernen.“
Nichts lernen wir aus der Geschichte, behaupte ich. Vor allem nicht aus ihren Fehlern.
Unser Gehirn ist nicht dazu programmiert, aus Fehlern zu lernen. Ein Einstellungsfehler vielleicht, aber die Evolution oder wer auch immer uns konzipiert hat, hat nichts aus diesem Fehler gelernt, sonst würden wir nämlich nicht die Umwelt kaputt machen und Kriege führen.
Würden Menschen aus Fehlern lernen, gäbe es keine gefährlichen Rückfallstäter. Sondern lauter liebe, sanfte Jungs, die geläutert säuseln: „Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, die Zeit im Knast hat mir total gut getan und ich habe diese Zeit für Meditation und wichtige Erkenntnisse genutzt. Ich habe dort andere, ebenfalls großartige Menschen kennengelernt, die wie ich aus ihren Fehlern gelernt haben. Jetzt möchten wir das Gute und Gelernte auch an andere Menschen weitergeben und in Männerstrick- und Gesprächsrunden die anderen Menschen lehren, aus ihren Fehlern zu lernen. Und wenn sie es nicht kapieren, werden wir es ihnen mit ein wenig Nachdruck und einem kleinen bisschen Gewalt eintrichtern; so lange werden wir sie mit ihren Köpfen in die eigene Scheiße stecken, bis sie kapiert haben werden, dass Gewalt kein Lösungsmittel ist.“
Wie gesagt, unser Gehirn kann das gar nicht, aus Fehlern lernen. Bei Lob und Anerkennung wird unser Belohnungszentrum aktiviert, bei Fehlern das Angstzentrum.
Beim Chinesisch lernen, beim Autofahren, eigentlich immer und überall lernen wir durch Fehler nichts. Außer Angst davor zu haben, den Fehler zu wiederholen. Vor lauter Angst prägen sich die Fehler tief in uns ein. „Bitte keine Ampel“, sagt mein Kind, „da stürzt er mir jedes mal ab.“ Sie rollt auf die Ampel zu, der Motor stirbt ab.
Beim Mandarin lernen gibt es Worte, die ich mir partout nicht merken kann. Schon, wenn ich das chinesische Schriftzeichen sehe, bekomme ich Herzklopfen und weiß: „Scheiße, es wird wieder falsch sein.“ Qien 2. Falsch. Scheiß Angst vor dem Fehler. Angst vor dem Versagen. Angst davor, nicht geliebt zu werden. Von der Sprachlernmaschine, die es rot aufleuchten lässt, von den hupenden Autofahrern, dem Kritiker, dem Leben.
Jetzt halten Sie mich vielleicht für eine Heilige. Keine Sorge, die bin ich nicht.
Im Literaturforum, in dem ich früher geschrieben hab, habe ich es geliebt, die Fehler der anderen aufzudecken und habe den anderen Schreibenden meine Kritik wie ein eiskaltes, nasses Handtuch um die Ohren gefetzt. Ich bin auf den Feldern der frisch gepflanzten Gedichte und Geschichte durch die Furchen gewandert und hatte an allem etwas auszusetzen. „Hier, das Pflänzchen ist beinahe verdorrt, und das hier wächst schief, und das hier hat keine Überlebenschance, reiß es aus! Aus dir wird nie ein guter Landwirt“, hab ich gesagt und bin unachtsam auf sprießende Pflanzen draufgetreten, „aber vielleicht kannst du etwas anderes besser, vielleicht stricken oder singen oder Mistkübel ausleeren.“
Ungefragt weise ich andere Menschen auf ihre Fehler hin, vielleicht, um mich nicht mit meinen eigenen zu konfrontieren. Ungefragt sagen wir anderen Menschen, wie sie richtig Mandarin sprechen, Autofahren, Wortpflanzen säen oder leben.
Anstatt ihnen einfach zu sagen, was sie gut machen. Was wir wertschätzen. Welche Erfolge sie haben. Und dass wir sie lieben, auch wenn ihnen der Motor abstirbt. Schwächen schwächen. Stärken stärken. Deshalb sollten wir die Stärken unserer Mitmenschen stärken.
Keine einfache Übung. Ich werde Fehler machen dabei. Und vermutlich nichts aus ihnen lernen.
testsiegerin - 25. Jul, 14:39
Sperrt die Wilden ein und gebt ihnen Namen! (Karl Popper)
Namen erwecken Dinge zum Leben. Fassungslos war ich, in dem kleinen griechischen Dorf vor vielen Jahren, als man die kleinen Kinder nur Baby (moro) gerufen hat. Einen Namen bekommen sie erst im Alter von sechs, hat man mir erklärt. Man weiß ja noch nicht, wie sie sich entwickeln, welcher Name zu ihnen passt. Vielleicht war aber auch alles ganz anders und meine Griechischkenntnisse zu schlecht, um es richtig zu verstehen. Der griechische Salat war wunderbar.
Namen machen Dinge und Projekte erst wirklich. Wir Toll3sten zum Beispiel, wir sind in dieser Formation nicht länger Katharina, Beate und Barbara; also natürlich sind wir das immer noch, aber wir sind viel mehr, indem wir die Toll3sten sind. Wir haben unserer Band mit dem Namen auch Gestalt gegeben. Uns sozusagen erschaffen.
Indem Eltern uns Namen geben, impfen sie uns mit Erwartungen und Ansprüchen. Werde!, sagen sie. "Werde, wie wir wollen, dass du wirst."
Namen prägen. Eine Barbara ist anders als eine Ingrid. Ein Marcel anders als ein Friedrich. Ein Waldemar anders als ein Kevin. Toll3ste Weiber anders als Drei Nette Mädels am Rande des Mädelssein.
Namen erfinden Menschen neu.
Wie wäre ich geworden mit einem anderen Namen? Reine Spekulation, ich weiß, aber lassen Sie mich ein wenig in die schwüle Sommerluft hineinschwurbeln und -spekulieren. Wie wäre ich geworden als Herta oder als Karin, das waren damals auch beliebte Namen, in den frühen Sechzigern? Barbara ist offen und weich. Also der Name auch. Barbra sagen die einen, Warwara die anderen, aber man kennt den Namen auch in fremden Ländern. Barbara, die Wilde, die Fremde. Vor allem sich selber fremd. Barbara, der Name kann gut getanzt werden, weich und offen. Barbara kann nicht gut tanzen.
Sperrt die Wilden ein und gebt ihnen Namen! Wenn man etwas einen Namen gibt, hat man weniger Angst. Ich habe keine Angst vor der fetten Spinne Susi in meinem Badezimmer. Vor der Nacktschnecke Elsa. Vor Fluppi, dem Fußpilz auch nicht. Wie könnte man vor etwas Angst haben, das Fluppi heißt?
Also, wie wäre ich geworden als Herta? Ohne jetzt die Hertas dieser Welt verunglimpfen zu wollen, aber vermutlich würde ich als Herta Faltenrock und gebügelte Rüschenblüschen tragen. (Ein schönes Wort; ein onomatopoetisches Rüschenblüschen. Man spürt die Rüschchen förmlich beim Aussprechen.) Als Herta hätte ich einen grünen Lodenhut und in der Schule hätten mir die Barbaras und Sabines und Beates eine Feder aus Papier gebastelt, mir in den grünen Lodenhut gesteckt und mich ausgelacht. Wie wir der Herta damals. Ich wäre Polizistin geworden und hätte mich Jahre später an den Lippenstift klauenden Barbaras und Sabines und Beates gerächt, indem ich sie eingelocht hätte. Ich hätte einen langweiligen Mann geheiratet, einen Numismatiker, der am Sonntag die Gartenzwerge abstaubt und Kinder bekommen, die den selben Haarschnitt wie der Gartenzwergrasen gehabt hätten. Noch später hätte ich mir die Pulsadern aufgeschnitten, weil ich die Welt nicht mehr ertragen hätte.
Als Hiltrud hätte ich wahrscheinlich irgendwann die FPÖ gewählt und blaue Socken und mich selbst in Vorurteilen verstrickt. Ich bin froh, dass ich mich als Barbara so gut wie niemals in Vorurteilen verstricke, vor allem nicht, was Namen betrifft.
Valentina hätte ich gerne geheißen. Als Valentina hätte ich schon aus Prinzip mein Russisch-Englisch-Dolmetsch-Studium abgeschlossen und wäre Doppelagentin geworden, berühmter noch als Mata Hari. Edward Snowdon wäre ein Lercherlschas gegen mich gewesen. Jeden Tag hätte man von mir in der Zeitung gelesen, in Steckbriefen „Wanted – Dead or Live“ oder anderen Kolumnen. Als Valentina wäre ich kein offenes braves, sondern ein verschlossenes, geheimnisvolles und spannendes Kind gewesen. Ich hätte viel geschwiegen, aber wenn ich etwas gesagt hätte, wäre das von immenser Bedeutung für die gesamte Weltgeschichte gewesen. Man hätte meine Worte schon als Baby aufgezeichnet und mittels modernster Techniken entschlüsselt und gedeutet. Meine Eltern wären einerseits sehr stolz auf mich gewesen, ich wäre ihnen aber schon in meiner frühen Kindheit ein wenig unheimlich gewesen. Trotz Namen hätten sie sich beinahe vor ihrem eigenen Kind gefürchtet.
Niemand dagegen würde sich vor drei Frauen fürchten, die sich Lust und Last von der Seele schreiben, hießen sie Die Lieblichen. Die Lieblichen würden auch keine Gangster- und Piratengeschichten oder halbpornografische Romane schreiben, sondern Heimatromane aus den Tiroler Alpen verfassen. Sie würden Zenzi, Annerl und Trude heißen und zu ihren Lesungen würden nur ein paar schwerhörige Jäger kommen, die sich an ihren aus den Dirndln quellenden Brüsten erfreuen.
So schauts nämlich aus.
testsiegerin - 23. Jul, 09:37
Ein neuer Tag. Ein neuer Anfang. Neue Chancen. Neues Spiel, neues Glück.
Die Karten werden neu gemischt. "Wer gibt?" Petrus sagt, er wäre nur fürs Wetter zuständig, "ich geb Sonne, Wärme, ein leichtes Lüftchen, sonst nichts, heute. Ich mag mich auch mal ausruhen."
"Gott soll geben", sagt jemand, "der ist dafür zuständig".
"Wie soll jemand geben, den es vielleicht gar nicht gibt?", wende ich ein. "Also ich geb nicht", sagt die Vergangenheit, "ich hab erst gestern gegeben." Schicksal und Glück streiten, als das Glück die Karten an sich reißen will. "Du kannst nicht geben", sagt das Schicksal, "weil du immer nur gute Karten gibst, und wie langweilig ist ein Spiel, in dem alle gewinnen." Jetzt mischt sich auch noch das Unglück ein. "Du würdest vor lauter Mitleid lauter Joker verteilen", sagt es, "aber mit lauter Jokern kann man nicht mal Jolly spielen. Neben den Trümpfen braucht es auch die Nieten, die Karten, die nichts wert sind und von allen anderen gestochen werden."
„Wer gibt?“, frage ich noch mal, schon ein wenig ungeduldiger.
„Na gut, dann geb ich halt wieder mal, bin ich ja gewöhnt“, seufzt das Leben. Es legt die Karten verdeckt auf den Tisch und verteilt sie mit offenen Händen, bringt sie in eine andere Formation, um sie danach wieder in einem Stapel zu sammeln. Ich sitze gespannt da und warte auf meine Karten. Hoffe auf ein paar Asse. Aber auch die können unangenehm sein, wenn jemand beim Bauernschnapsen einen Bettler ansagt. Und die Glatze beim Tarock, die so ausschaut wie ein Ass, die ist genau Null wert.
„Was wird überhaupt gespielt?“, fällt mir rechtzeitig ein.
„Ach, das ist nicht so wichtig“, sagt ein Mitspieler. „Wenn das Leben gibt, spielt jeder sein eigenes Spiel.“
„Und nach welchen Regeln?“
Der Anarchist unter den Spielern lacht.
Ich sortiere die Karten in meiner Hand, als mir auffällt, dass nicht einmal die Anzahl der Karten gerecht verteilt ist.
„Uno“, sagt die Spielerin links von mir und freut sich. "Ich bin gleich fertig."
Ich hab noch nicht mal angefangen, denke ich. In einem unbeobachteten Moment schiebe ich mir den Herzkönig in meinen Ärmel. Wer weiß, wofür der noch mal gut ist.
„Vierzig“, sagt mein Gegenüber an.
„Fünfzig“, gebe ich zurück. „Fast schon 51.“
Ich habe den Sküs, den Narren, in der Hand, die höchste Karte im Tarock, aber niemand will Tarock spielen.
„Zu kompliziert“, sagt der Eremit und legt eine Patience. Sie geht nicht auf, wie alle anderen zuvor.
So sehr hab ich mich aufs Spiel gefreut und so einsam fühle ich mich jetzt. Wütend schmeiße ich meine Karten auf den riesigen Tisch. „Ich spiel nicht mehr mit!“, schreie ich, aber auch das scheint den anderen egal zu sein. Das Kind neben mir – oder ist es das Kind in mir? – sortiert selbstverliebt seine Rennauto-Karten. „3.200 Kubik“, sagt es, und „260 PS.“ Es braucht nur noch den roten Ferrari zu seinem Glück.
Der Spieler mit der dunklen Brille pokert hoch. „All in“, schiebt er alle Jetons in die Mitte des Spieltisches. Alles oder nichts. Leben oder Tod.
Die weißhaarige Alte, möglicherweise eine Weise, breitet ein rotes Samttuch aus und breitet darauf kunstvoll das Blatt fächerförmig aus. „Leg die linke Hand auf dein Herz und zieh eine Karte“, befiehlt sie. Ich lege. Ich ziehe. Ich schaue.
Die XIII. Ein weißes Pferd. Darauf ein Skelett in einer Ritterrüstung. Der Tod. In seiner Hand eine schwarze Flagge mit einer weißen Rose. Im Hintergrund eine Sonne. Geht sie auf? Geht sie unter?
Als die weise Weiße das Entsetzen in meinen Augen flackern sieht, streicht sie mir beruhigend über den Arm. „Der Tod steht auch für einen Neubeginn“, sagt sie. „Jeder Tag ist ein neuer Anfang.“ Und dann kichert sie hämisch. „Aber nicht für jeden.“
testsiegerin - 21. Jul, 12:36
Spätestens, als sie mir gesagt hat, dass sie Bewusstseinsforscherin ist, hätte ich misstrauisch werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich aber noch, jeder und jede kann sein, was er will, Autorin, Bungeejumper, Seifenbläserin, Bankmanager, Urologin... warum also nicht Bewusstseinsforscherin? Und überhaupt. Bin ich etwas anderes als Bewusstseinsforscherin, wo ich seit Wochen Tag für Tag in mein Forscherinnentagebuch schreibe? Vielleicht sollte ich es Bewusstseinsforscherinnentagebuch nennen? Ich forsche in meinem Bewusstsein, noch nicht ganz aufgewacht, nicht mehr ganz im Tiefschlaf. Ich schürfe an der Oberfläche meines mittleren Unbewussten. So schaut’s nämlich aus.
Wie gesagt, ich war nicht sofort auf der Hut, nicht skeptisch, vielleicht, weil ich das prinzipiell nicht bin. Manche nennen das Naivität, ich nenne es Offenheit. Außerdem habe ich mich geschmeichelt gefühlt, als die Frau nach der Lesung zu mir kam und mit mir über einen Text sprechen wollte. Über den Brief an mein großes Kind. Als Autorin hab ich mich geschmeichelt gefühlt und auch als Mutter. Ein Mensch, der so viel Interesse an uns zeigt, kann kein schlechter Mensch sein, oder?
Nach der Diagnose hat sie mich gefragt. Und ich, die ich jahrein, jahraus mit Menschen mit Diagnosen arbeite, merke, dass sie mich zunehmend wütend machen. Die Diagnosen, nicht die Menschen. Sie beschreiben immer Defizite, immer das, was abweicht von der oder fehlt zur sogenannten Normalität. Es gibt nicht die Diagnose „liebenswerter, offener, junger Mann“. Und trotzdem tun wir so, als wären Diagnosen so etwas wie ein Code, der uns hilft, Menschen besser zu verstehen. In Wahrheit hindern sie uns daran, weil sie das Bild in uns festigen und unsere Vorurteile einzementieren. Diagnosen sind nur ein Stempel, den uns irgendwann jemand auf die Stirn gedrückt hat, damit er sich nicht die Mühe machen muss, in unsere Herzen zu schauen. Mit einer Farbe, die sich nicht wegwaschen lässt, ohne die Haut mitabzulösen. Wir können sie nicht wegschrubben, die Stempel, auch wenn sie längst nicht mehr zu uns passen.
Wir brauchen sie, die Diagnosen, weil sie uns helfen, Ordnung zu schaffen. Alles brav einsortieren in die vorhandenen Laden; die Zuckerkranken, die mit Krebs, die Depressiven, die Alkoholiker, die Autisten... Es gibt uns Sicherheit. Ganz unsicher macht es uns, wenn wir jemanden nicht einordnen können, weil er in keine Kategorie passt.
Auf meiner Stirn sind viele Stempel. Stark – den hat mein Vater gleich nach der Geburt ins Stempelkissen und anschließend auf meine Stirn gepresst. Schlampig und faul haben sie später dazugeprägt, Sie-könnte-ja-wenn-sie-nur-wollte, hat die Lehrerin einen freien Platz auf der Stirn gesucht und gefunden, aber auch begabt und witzig.
Nur, damit Sie nicht glauben, ich wäre etwas Besseres, auch ich bin Besitzerin einer ganzen Batterie von Stempeln in allen Formen und Stempelkissen in allen Farben, an denen ich mich fleißig bediene.
Zurück zur Bewusstseinsforscherin. Sie will Details über meinen Sohn wissen; welche Therapien er hinter sich hat und ob er eine Freundin hat und was er beruflich macht und wie er in die Familie eingebunden ist. Ich antworte brav und voll mütterlicher Liebe und Stolz – und dann kommt die Klatsche.
Dass es nur um mich gehe, meint die Bewusstseinsforscherin, und dass ich Probleme hätte damit, das spürt sie an meiner Aura. Sie habe schließlich jahrelang im Wald gelebt und bei den Schamanen, sie wisse mehr als eine Psychologin, sie fühle das an meiner Energie. Meine Freundlichkeit wird bemühter, ich würde sie gerne abschütteln, mich wieder den Leuten an meinem Tisch zuwenden, ich will mir meine Ohren zuhalten und nicht hören, was sie sagt, aber das spürt sie nicht. Sie hat mich fest in ihren Klauen. Und obwohl ich weiß, dass es Mist ist, was sie redet, dass es ausschließlich mit ihr zu tun hat, was sie sagt, und nicht mit mir und schon gar nicht mit meinem Kind, tut es weh. Ich will nicht unhöflich sein, ich eigne mich nicht für Publikumsbeschimpfungen.
„Du schilderst alles nur aus deiner Sicht“, sagt sie, „es geht dir nur um dich! Aber wie sieht denn dein Sohn die Welt?“ Ich maße mir nicht an, zu wissen, wie er sich selbst und die Welt wahrnimmt, aber er vermittelt mir und den anderen hier täglich den Eindruck, dass er im Reinen ist, mit sich und der Welt. Er strahlt von seinem Traktor, erzählt von der Weizenernte und schneidet die Hecken zurück.
Ich kann mich nicht anders von der Bewusstseinsforscherin lösen als mich physisch zu entfernen.
Als ich zurückkomme, ist sie weg. Nicht ohne vorher meine Freundin des Kindesmissbrauchs bezichtigt zu haben, weil auch sie ihren kleinen Sohn missbrauche und einen offenen Brief an ihn vorgelesen hat. Nicht ohne einen Sessel umzustoßen, zu fluchen und uns des Energieraubes zu beschuldigen.
Ich krame in meiner Tasche nach den Stempeln. Zwei finde ich. Der erste ist für mich und meine Freundin. Rabenmutter, steht drauf. Den zweiten kriegt die Bewusstseinsforscherin: Psychisch krank.
Und da war noch Frau H. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine schöne Geschichte.
testsiegerin - 20. Jul, 12:46
Der Staatsanwalt plädiert selbstzufrieden auf Schuldig im Sinne der Anklage.
„Welcher Verbrechen habe ich mich schuldig gemacht?“
Der Richter lächelt milde, obwohl er mich hart bestrafen wird. „Denken Sie einmal scharf nach, Frau Lehner.“
Ich denke scharf nach, obwohl mir das um diese Uhrzeit schwer fällt. Ich fühle mich augenblicklich schuldig, wie ich mich schuldig fühle, wenn ich ein Polizeiauto sehe oder einen eingeschriebenen Brief bekomme oder einen Anruf der Bank. Mir fällt kein konkretes großes Vergehen ein, gegen das ich verstoßen haben soll, nur viele kleine. Vielleicht ist es ja die Summe dieser Vergehen, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat wie ein sanfter, sanfter Regenguss, auf den eine schreckliche Mure folgt.
„Die sieben Todsünden und so?“, schlage ich vor. Mit denen bin ich auf Du und Du. Auch wenn mir manchmal ihre Namen nicht einfallen.
Die Wollust, die ist leicht. Die wichtigste. Die schönste auch. Die Trägheit. Liegt grad neben mir im Bett. Nein, ich meine nicht meinen Mann. Der hat es gut. Er ist nie an irgendetwas schuld, zumindest fühlt er sich nie schuldig; zumindest tut er so, weil er die Schuld, sobald sie auch nur in seine Nähe kommt, brüsk von sich stößt und diese mit aller Wucht auf mich fällt. Also Wollust und Trägheit. Stolz, natürlich. Und wie stolz ich auf alles bin. Auf meine Erfolge, meine Kinder, meine Talente, meinen Rhabarberstrudel. Wollust, Trägheit, Stolz. Drei haben wir schon. Fehlen noch vier. Wie konnte ich auf die Maßlosigkeit vergessen? Genug ist nie genug. Ich halte gern ein Maß.
Der Richter trommelt mit den Fingerkuppen auf die alte Richterbank aus Mahagoni. „Na Frau Lehner?“
„Die Ungeduld. Ich bekenne mich der Ungeduld schuldig.“
Jetzt wird das Lächeln des Richters spöttisch. „Sie sind so einfältig.“
Einfalt auch? Ungeduld und Einfalt gehören doch gar nicht zu den Big Seven. Trotzdem nervt sie, die Ungeduld, mit allen, die langsam, dumm und ahnungslos sind.
„Ich gelobe Besserung, Herr Rat.“ Vielleicht erhöht das meine Chancen auf eine milde Strafe. „Neid?“, frage ich unsicher. „Neid und Geiz?“
„Wie jetzt“, seine Ungeduld wird größer, „entscheiden Sie sich!“
„Beides. Ich entscheide mich für beides“, klaue ich das Lieblingswort meiner Freundin. Ich beneide sie um ihr Lieblingswort. Meines ist Liebe. Beides klingt viel verwegener, unbescheidener, so viel maßloser als die abgeschmackte Liebe. Die wir abgeschmackt haben, weil wir ihr Wort und ein bisschen auch sie selbst täglich missbrauchen. Aber Wollust als Lieblingswort war auch schon vergeben, das hat die andere Freundin sich gegrabscht. Hätte ich Zeit zum Nachdenken gehabt, ich hätte mir ein anderes Wort als Lieblingswort ausgesucht. Habseligkeiten vielleicht, oder ein anderes vom Aussterben bedrohtes Wort. Die Liebe ist auch vom Aussterben bedroht. Irgendwann wird sich niemand mehr daran erinnern können, sie niemand mehr sehen wollen, weil sie durch die ständigen Vergewaltigungen unansehnlich und bedeutungslos geworden ist.
„Waren wir jetzt schon durch mit den Todsünden?“, schaue ich zum Richter hoch und zähle sie alle noch einmal auf Stolz, Trägheit, Maßlosigkeit, Wollust, Neid, Geiz, Ungeduld und Einfalt. Was noch? Mir fällt keine mehr ein. "Ich werde später die Todsünden lernen, und zwar so, dass ich sie mir auch bestimmt merke“, verspreche ich dem Richter, dem das egal zu sein scheint.
Er klopft mit dem Hammer auf die Stelle der Richterbank, die vom vielen Verurteilen, von vielen Vorurteilen, schon eine tiefe Delle hat. Zum Ersten, zum Zweiten... Ich denke nach. Soll ich noch höher gehen?
„Ich bin Mutter“, presse ich hervor, „damit bin ich per Definitionem an allem schuld.“
„Und zum Dritten.“
Stille im Verhandlungssaal. „Frau Lehner ist schuldig im Sinne der Anklage“. Der Staatsanwalt klopft sich stolz an die Brust. Der Richter rollt mein prallgefülltes Vorstrafenregister auf. Ich halte mir Augen und Ohren zu, aber das will nicht klappen, mit 2 Händen und 4 Sinnesorganen.
„Mildernd ist die tätige Reue.“
Nein, ich bereue nichts, denke ich, nicke aber theatralisch zu den Worten des Richters. Ich bereue nur, worauf ich mich nicht eingelassen habe. Aber das gebe ich nicht zu.
„Mildernd wirkt auch das Geständnis der Angeklagten. Frau Lehner, Sie haben das letzte Wort.“
Mein Verteidiger, denke ich, wo ist mein Verteidiger? Sie haben mir keinen zur Seite gestellt, nicht mal einen klitzekleinen, unfähigen Pflichtverteidiger in Ausbildung.
Stroboskopblitze im Saal. Journalisten mit Plüschmikrofonen. Alle warten darauf, dass ich etwas sage.
Geschwätzigkeit, denke ich, Geschwätzigkeit ist meine siebente Todsünde.
Und schweige.
testsiegerin - 19. Jul, 10:15